
Es war einmal ein Marquis
Erscheinungsdatum: 5.9.2016
Originaltitel: „Once Upon a Marquess“
1. in der Worth Serie
Der letzte Mensch, den Judith Worth je wiedersehen wollte, ist Christian Trent, Marquis of Ashford. Der Mann, der seine Ferien im Haus ihrer Familie verbracht hat und der sie an einem verzauberten Sommerabend geküsst hat – nur um kurz darauf kaltherzig ihre Welt zum Einsturz zu bringen. Aber jetzt, acht Jahre später, braucht sie in einer geschäftlichen Angelegenheit Hilfe, und er ist der Einzige, an den sie sich wenden kann.
Ashford konnte Judith nie vergessen, auch wenn er weiß, dass sie ihm nie verzeihen wird. Als sich die Möglichkeit bietet, etwas für sie zu tun, ergreift er kurz entschlossen die Gelegenheit. Sein ganzes Leben lang hat er stets das Richtige getan. Aber nun tut er etwas, das völlig falsch ist – und verliebt sich in die eine Frau, die er nie haben kann …
Das Buch kaufen:
thalia | weltbild | weltbild ebook.de | buecher.de | buch.de
„Wenn ich [Milans] Bücher lese, weiß ich, dass nicht nur etwas Gutes auf mich zukommt, sondern etwas Hervorragendes, Außergewöhnliches und Tiefgründiges.“
—Sarah Wendell, Smart Bitches, Trashy Books
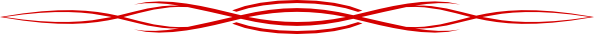
London, England, 1866
Wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, seinem Empfinden Ausdruck zu verleihen, hätte der Teetisch gestöhnt. Kekse, Orangen, Likör und zwei Sorten Marmelade waren nur der Anfang der Lasten, unter denen sich das bemitleidenswerte Möbelstück nun bog. Sandwiches und Scones würden noch hinzukommen. Die Zuckerschüssel war gefüllt, der Teekessel stand bereit, um der kleinen Menge Darjeeling, zu einem viel zu hohen Preis erworben, ein standesgemäßes Gefäß zu bieten. Das Parkett im vorderen Salon war sauber geschrubbt worden, und ein fröhliches Sträußchen Veilchen, dem Blumenmädchen unten am Markt abgekauft, zierte ein Beistelltischchen.
Es war drei Monate her, dass Judith Worth das letzte Mal ihren jüngsten Bruder gesehen hatte, und nichts – nichts – würde seine Heimkehr stören. Alles entwickelte sich endlich richtig. Beinahe alles, wenn man es genau nahm. Aber sobald sie das letzte unselige Problem mit ihren Schwestern gelöst hatte, würde es wirklich alles sein.
„So.“ Judith pflückte die orangefarbene Katze vom Tisch.
Karamell war hinaufgesprungen, um diese seltsame und zweifellos interessante Zusammenstellung von Sachen zum Herunterschubsen näher zu untersuchen, und sie miaute protestierend, weil ihr Plan vereitelt worden war. Judith schob die Sandwiches zurecht. Damit blieben nur noch …
„Theresa“, rief Judith, „wo hast du die Scones hingetan?“
Keine Antwort. Judith spähte in den Flur, aber niemand blickte von da aus zu ihr zurück außer Squid, eine weitere von Theresas Katzen. Der Kater leckte sich eine Pfote, während er Judith voller Argwohn musterte und dazu mit seinem Schwanz zuckte.
„Theresa!“, rief sie.
„Was?“ Ihre jüngste Schwester war nicht in der Küche, wo sie eigentlich Gebäck auf Teller hätte legen müssen. Sie stand am Fenster im vorderen Zimmer, ihre gertenschlanke Gestalt halb verborgen von den Vorhängen, die Judith erst kürzlich zum Waschen gegeben hatte.
Judith seufzte. „Damen sagen nicht ‚Was?‘. Sie sagen ‚Wie bitte?‘ oder ‚Ja, Judith?‘.“
„Aber ich habe ‚Was?‘ gesagt.“ Theresa dachte mit gerunzelter Stirn darüber nach. „Also sagen Damen es sehr wohl, in welchem Fall du nicht recht hättest, oder ich bin keine Dame, und dann muss ich auch nicht ‚Wie bitte?‘ sagen.“
Andere Leute würden glauben, dass ihre Schwester frech wäre. Aber Theresa war einfach so ‒ und außerdem gab es Wichtigeres zu tun.
„Was hast du mit den Scones getan?“, fragte Judith.
„Wie bitte?“
„Was hast du mit den Scones getan?“, wiederholte Judith.
„Wie bitte?“, erwiderte Theresa.
„Um Himmels willen.“ Judith holte tief Luft und zwang sich, im Geiste zu zählen. Eine Wildente. Zwei Wildenten. Drei … „Ich meinte nicht, dass es dir nur erlaubt ist, ‚Wie bitte?‘ zu sagen.“ Die Geduld nicht zu verlieren fühlte sich wie eine Herkulesaufgabe an. „Sondern einfach nur, dass es besser ist, als ‚Was?‘ zu rufen wie eine gemeine Spülmagd. Und jetzt, bitte, beantworte mir meine Frage.“
„Oh, ich hab schon verstanden, was du meintest“, entgegnete Theresa. „Aber du hast ‚Was‘ gesagt, und ich weiß, du betrachtest dich selbst als Dame. Ich habe dich nur verbessert.“
„Ich habe ‚Was‘ gesagt? Nein, niemals.“
„‚Was hast du mit den Scones getan?‘“, wiederholte Theresa. „Obwohl ich zugeben muss, dass ‚Wie bitte hast du mit den Scones getan?‘ schon extrem seltsam klingt. Das kann kein richtiges Englisch sein.“
Eine Wildente. Zwei … Nein. Schluss mit den Wildenten. Egal, wie viele Wildenten sie im Geiste zählte, es würde nicht helfen. Sie hatte ihrer Schwester eine einzige Aufgabe für den ganzen Vormittag gegeben: Kümmere dich um die Scones. Wie schwer konnte das schon sein?
Sie holte tief Luft. „Theresa, wo sind die Scones?“
Theresa runzelte die Stirn und schaute sich um, als versuchte sie, herauszufinden, wo sie sie hingestellt hatte. Der kleine vordere Salon hielt keinem Vergleich mit dem stand, was ihre Familie einmal besessen hatte. Früher einmal hätte Judith die Sandwiches nicht selbst machen und sie auch nicht persönlich auf den Tisch stellen müssen. Früher einmal wären die Schüsseln aus Porzellan gewesen, und ihr jüngerer Bruder wäre von einem Paar Lakaien in einer Kutsche hergebracht worden, statt vom Bahnhof zu Fuß nach Hause gehen zu müssen.
Aber es war witzlos, alle „Früher einmal“ zu zählen. Früher einmal war nicht jetzt. Jetzt gab es Sandwiches, und es gab einen Tisch, und solange in Judith noch ein Funken Leben war, würde Familienmitglieder zu Hause immer ein herzliches Willkommen erwarten.
Natürlich immer vorausgesetzt, dass sie die Scones finden konnte.
Trotz Judiths notwendigerweise leider nur sporadischer Bemühungen, ihrer Schwester damenhaftes Verhalten beizubringen, schien Theresa immer irgendetwas mit den Händen tun zu müssen. Ihre Finger zupften wie aus eigenem Antrieb eine Haarsträhne aus den zu einem Krönchen hochgesteckten blonden Zöpfen auf ihrem Kopf.
„Scones.“ Judith klopfte mit dem Finger auf den einzigen freien Platz auf dem Tisch.
„Richtig.“ Theresa kaute langsam auf einer Haarsträhne. „Ach ja, die. Ich hab mich ablenken lassen.“
Manche Leute dachten, Theresa sei dumm, doch das stimmte nicht, nicht mal ansatzweise. Sie besaß nur die Form von Klugheit, die es nicht im Geringsten interessierte, was andere dachten, sodass man sie oft mit Dummheit verwechselte. Wenn sie sich dazu bringen konnte, lang genug still zu sitzen, um zu lesen, begriff sie alles, aber sie war stets abgelenkt – oder lenkte sich selbst ständig ab. Sie war schwierig gewesen von dem Moment an, als sie auf die Welt gekommen war.
„Konzentrier dich“, verlangte Judith. „Fang vorne an. Du hast die Scones aus dem Ofen genommen. Was ist dann passiert?“
„Nein, vorher“, verbesserte Theresa sie. „Ich bin abgelenkt worden von der Leiche auf der Vordertreppe.“
Judith verzog das Gesicht. „Mist. Nicht noch eine tote Ratte. Sag mir bitte, dass sie wenigstens in einem Stück ist. Oder war Squid da schon dran?“
Theresa drehte sich wieder zum Fenster um. „Ich glaube nicht, dass wir Squid für diesen Leichnam verantwortlich machen können. Er sieht menschlich aus und fällt damit nicht in sein Beuteschema.“
Judiths Kopf war ganz leer. Langsam – weil irgendjemand ja schließlich etwas unternehmen musste – schlich sie vorwärts und spähte durch die Vorhänge. „Oh“, hörte sie sich selbst sagen, wie aus großer Entfernung, „du hast recht. Ich denke nicht, dass Squid dafür verantwortlich …“
„Natürlich nicht“, erklärte Theresa. „Er ist wirklich eine großartige Katze.“
Judiths Augen schienen nicht fokussieren zu können. Früher einmal hatte es keine Leichen gegeben, nirgendwo im Umfeld der Familienbesitzungen.
Eigentlich hatte sie geglaubt, dass es in der Gegenwart auch so sein würde. Das Viertel, in dem sie lebten, war überfüllt und eng, aber es war immerhin sicher hier. Wenigstens hatte sie das immer geglaubt. Das Ding – sie fand es leichter, von dem, was auf ihrer Türschwelle lag, als „Ding“ zu denken – lehnte reglos am Treppengeländer, die Glieder in merkwürdigem Winkel abgespreizt, komisch verdreht und mit abgeknickten Gelenken. Zotteliges Haar unter der Kappe – eventuell blond – verbarg das Gesicht. Ein grünblauer Schal war um den Hals gewickelt.
Etonblau. Ihr blieb das Herz stehen. Aber dieses … Ding war zu klein, um ihr Bruder zu sein. Ihr Puls setzte mit einem schmerzhaften Pochen wieder ein, als sie ein letztes Detail wahrnahm: Ein Messergriff ragte aus der Brust.
„Warte hier“, trug sie Theresa scharf auf.
Früher einmal hätte sie vielleicht geschrien, aber jetzt war sie längst darüber hinaus, irgendwelche Anfälle zu bekommen. Lady Judith Worth – dieses mitleiderregende Exemplar holder Weiblichkeit, das am Ende ohnmächtig zu Boden gesunken wäre – hatte zu viel überstanden, um jetzt zu zögern. Sie drehte den Schlüssel im Schloss der Haustür um und stieß die Tür auf.
Eine Brise, die nach dem Rauch der Fabrik drei Blöcke weiter roch, wehte ihr entgegen. Die Straße war praktisch leer, der Tag ungewohnt grau und kalt für den Sommer. Kleine Nebelschwaden begrüßten sie, hingen über dem Abfall, der sich in der Gosse gesammelt hatte. Dreißig Meter weiter, beinahe verborgen von dem Nebel, rührte Old Mother Lamprey in einem großen Suppenkessel neben der Straße. Ein Mann lief an ihr vorbei, hielt sich den Mantel vorne zu und blickte argwöhnisch nach rechts und links. Leider sah niemand so aus, als hätte er gerade eine Leiche hier zurückgelassen.
Apropos Leiche. Judith machte einen Schritt nach vorne, betrachtete das Ding aus schmalen Augen und atmete erleichtert auf. Kein Wunder, dass Arme und Beine so unnatürlich gewirkt hatten. Es war gar keine Leiche – dieses Ding hatte nie gelebt. Es waren einfach ein paar Kleider, mit Heu ausgestopft, eine Strohpuppe, wie man sie oft Anfang November brennen sah.
Aber jetzt war Juli. Bis zum Guy Fawkes Day war es noch lang. Und das hier waren nicht einfach nur ein paar Kleider, es war die blaue Stoffuniform eines Eton-Schülers, komplett mit Abzeichen. Wer auch immer dieses groteske Ding hier abgeladen hatte, hatte ein Messer durch die Stelle gestoßen, wo das Herz sein müsste, und den Körper so an das Treppengeländer genagelt. Es war eine rostige Klinge mit einem gesplitterten Griff, aber ein Messer musste ja nicht scharf sein, um tief zu verwunden.
Judith hatte genau dieses Tableau zuvor gesehen. Es war auf den Karikaturen von ihrem Vater gewesen, die überall in den Schaufenstern gehangen hatten: mit durchbohrtem Herzen an einer Wegkreuzung verscharrt, wie es früher allen Selbstmördern ergangen war.
Es gab einen Grund, warum sie keine Verwendung mehr für Märchen hatte.
Zögernd trat sie zu dem Strohleichnam und umfasste den Messergriff. Wenn sie nur fest genug zupackte, würden ihre Hände aufhören zu zittern – einfach so. Mit einem Ruck zog sie an dem Griff.
Einen Moment lang widersetzte sich die Klinge, sodass Splitter durch ihre Handschuhe drangen. Dann löste sie sich so plötzlich aus dem Holzpfosten, dass Judith unwillkürlich rückwärtsstolperte.
Ein Stück Papier, zu einem Rechteck zusammengelegt und sorgfältig so klein gefaltet, dass sie es zunächst gar nicht bemerkt hatte, steckte auf der Klinge. Sie zog es ab und faltete es auseinander.
Für Benedict Wertlos, stand darauf, Sohn eines Verräters. Wir freuen uns auf das nächste Semester. Komm und mach Dich auf was gefasst. Oder besser noch, krieche davon wie der feige Abschaum, der Du bist, und kehre nicht zurück.
Es war schlicht unterzeichnet mit Du weißt, wer.
Wut färbte ihr Sichtfeld rot. Ihr kleiner Bruder. Das war ihr kleiner Bruder, von dem sie hier sprachen, ihr lieber zwölfjähriger Junge. Sie hatte ihn praktisch selbst großgezogen. Sie hatte für ihn gekämpft. Sie hatte geknapst und geknausert, eisern gespart, und als Geld ihr nicht die Türen geöffnet hatte, hatte sie sich aufs Reden verlegt. Sie hatte keine Ruhe gegeben, bis die Treuhandverwalter zögernd zugestimmt hatten, ihren Bruder nach Eton gehen zu lassen, zunächst einmal für das Sommersemester. Sie hatte jahrelang sorgsam darauf hingearbeitet, dass er die Chance erhielt, den Platz einzunehmen, der ihm von Rechts wegen zustand.
Und Du weißt, wer hatte ihm bildhaft ein Messer ins Herz gestoßen. Und sie hatten ihn wertlos genannt.
Nach dem Skandal mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder hatte sie nicht geglaubt, dass Benedict beliebt sein würde. Wenigstens nicht am Anfang, aber sie hatte gehofft, wenn es ihr gelänge, Benedict auf die Schule zu bringen, würden sein herzliches Lächeln und sein trockener Humor die anderen Jungs schließlich für ihn einnehmen.
Dumm. Das kam davon, wenn man an Märchen glaubte. Solche sehnsüchtigen Wünsche wurden nie wahr, wenigstens nicht für ihre Familie.
Aber das war egal. Vor acht Jahren hatte Judith sich geschworen, dass ihr Bruder und ihre Schwester ein Leben haben würden wie das, in das sie hineingeboren worden waren – gleichgültig, was sie würde tun müssen, um das zu erreichen. Sie hatte sich nicht gegen schier unmögliche Widrigkeiten durchgesetzt, nur damit ein paar niederträchtige Schuljungen Benedicts Chancen ruinierten.
„Es ist keine sehr gute Leiche“, bemerkte Theresa hinter ihr. „Die Beine sind zu kurz im Verhältnis zum Torso. Findest du nicht auch?“
„Theresa“, sagte Judith. „Glaubst du, es zeugt von guten Manieren, Leichen zu kritisieren?“
„Vermutlich nicht.“ Theresa zuckte die Achseln. „Aber es zeugt von Humor.“
Judith wechselte das Thema. „Ich dachte, ich hätte dir aufgetragen, im Haus zu bleiben.“
„Aber ich wollte es sehen.“
Judith seufzte. „Eine Dame tut, was man ihr aufträgt.“
Das quittierte Theresa ebenfalls mit einem Achselzucken. „Das ist eine völlig nutzlose Regel. Wozu sich überhaupt die Mühe machen, sie zu formulieren? Wenn ich eine Dame bin, sage ich mir einfach selbst, dass ich tun soll, was mir gefällt. So kann ich es jedem recht machen.“
Judith warf einen Blick zu ihrer Schwester. Das war nicht der richtige Zeitpunkt, auf Logik herumzureiten. Das Wichtigste zuerst: Sie musste das Ding hier loswerden, ehe Benedict heimkam. Wenn das die Begrüßung war, die ihn bei seiner Ankunft erwartete, hieß das, dass er in den letzten paar Monaten vermutlich genug Erniedrigungen erduldet hatte. Diese letzte würde sie ihm ersparen. Sie kniete sich vor die behelfsmäßige Leiche, fasste sie an Armen und Beinen und hob sie hoch.
Das Hinterteil geriet ins Rutschen, glitt an ihr nach unten und verteilte dabei Stroh auf die Stufen vor dem Haus.
Judith biss die Zähne zusammen, verlagerte ihr Gewicht und versuchte, den Strohmann anders zu halten. Er war sperrig, und sie konnte nicht sehen, wohin sie ihre Füße setzte, aber sie gab nicht auf. Eine Stufe nach unten. Dann die zweite. Die dritte fand sie mit ihrer Schuhspitze, aber während sie sich vorwärtstastete, verlor sie auf dem losen Stroh das Gleichgewicht. Sie griff nach dem Handlauf. Während sie das tat, löste sich einer der Arme und traf sie im Gesicht, sodass Heu über sie regnete.
Sie ließ die Strohfigur fallen und rieb sich die brennenden Augen. Entweder würde sie sie auseinandernehmen müssen – und dafür war keine Zeit – oder …
Der Mann, der vor ein paar Minuten an Old Mother Lamprey vorbeigegangen war, hatte keine Suppe bei ihr gekauft. Stattdessen war er der Straße weiter gefolgt, auf Judith zu. Er blickte stirnrunzelnd zu dem Haus zwei Türen weiter, holte einen Zettel aus seiner Tasche, spähte argwöhnisch darauf.
Judith traf eine spontane Entscheidung. Sie drückte die Schultern nach hinten und ging auf ihn zu.
„He, Sie da“, rief sie. „Guter Mann.“
Der Angesprochene richtete sich auf und wandte ihr halb den Kopf zu.
„Ja“, sagte sie etwas lauter. „Sie dort. Ich hab eine Aufgabe für Sie, wenn Sie sich einen Shilling verdienen möchten. Es dauert nicht mal fünf Minuten.“
Jetzt drehte er sich ganz zu ihr, und in dem Augenblick begriff Judith ihren Fehler. Sie kannte diesen Mann, und er brauchte ihren Shilling nicht. Sie hatte ihn sich immer als unangenehmen Menschen vorgestellt. Sie hatte zugelassen, dass ihre Gefühle ihre Erinnerung beeinflussten, hatte seinen geraden Rücken gebeugt und die amüsiert funkelnden Augen enger zusammengerückt.
Die Wirklichkeit war jedoch ganz anders. Kleine schwarze Locken lugten unter seinem Hut hervor. Seine Hosen waren sorgfältig gebügelt und sauber, sein Rock maßgeschneidert, sodass er perfekt die breiten Schultern umschloss. Unter dem frischen Schlamm von der Straße besaßen seine Stiefel das satte, schimmernde Schwarz, das nur ein hingebungsvoller Kammerdiener erzielen konnte. Dunkle, dichte Brauen lagen über intelligenten Augen von einem helleren Braun. Es waren lächelnde Augen, schelmische Augen, Augen, die sagten, dass ihr Besitzer einen guten Witz kannte, und wenn man sich vorbeugte, würde er ihn einem auch erzählen.
Diese Augen logen. Sie kannte sie nur zu gut.
Er machte einen Schritt auf sie zu. „Da bist du ja, Judith. Natürlich helfe ich dir.“ Seine Lippen zuckten. „Und du musst mich auch nicht bezahlen. Wir sind schließlich alte Freunde, oder?“
Es war acht Jahre her, dass sie ihn das letzte Mal leibhaftig gesehen hatte. Sein Anblick ließ sie erstarren, beraubte sie vorübergehend der Sprache. Ausgerechnet jetzt, da sie gerade an Märchen, die schiefgegangen waren, gedacht hatte. Es war einmal ein Marquis … und Lady Judith Worth hatte geglaubt, er würde die Welt im Sturm erobern.
Und das hatte er getan. Sie hatte damals nur nicht begriffen, dass er sie ihr dabei wegnehmen würde.
„Nun gut.“ Sie schluckte. „Lord Ashford. Sie hier zu sehen, hatte ich nicht erwartet, aber ich vermute, ich werde mich wohl mit Ihnen begnügen müssen.“
Einen Moment lang geriet dieses ewige Lächeln auf seinen Lippen ins Wanken. Er blickte ihr in die Augen, und sie spürte, wie sie ein kalter Windhauch umwehte.
„Tja“, sagte er schließlich. „Das werden Sie wohl.“